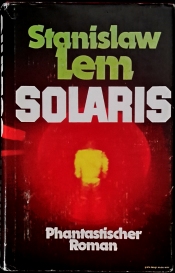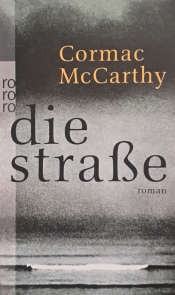Datum: Freitag, 27. Jänner 2017
Location: Gasometer Wien (Wien)
Tour: The Last Tour
Headliner: Sabaton
Support: Accept – Twilight Force
Ticketpreis: 41,10 Euro (VVK)
Kriegsberichterstattung.
Zugegeben: Obiger Titel ist ein bisschen martialisch. Aber SABATON sind halt auch eine merkwürdige Mischung, da geht das schon. Denn die Schweden haben lyrisch außer Krieg, Krieg und nochmals Krieg nicht viel in petto (von seltenen Ausnahmen á lá „Swedish Pagans“ abgesehen), was aber rein gar nichts an der guten Laune ändert, die die sympathische Truppe durchgehend verbreitet. Interessant, wie das zusammen passt – aber wenn die Songs halt derartige Hits sind und die Texte so zum Mitgrölen einladen, machen auch ernste Themen Laune. Im Übrigen hat man bei SABATON nie das Gefühl der Glorifizierung historischer Ereignisse, bei denen es viele, viele Tote zu beklagen gab. Umso spannender, wie hier eigentlich gegenläufige Musik und Lyrics zusammengehen.
Im Wiener Gasometer war die Halle jedenfalls brechend voll, mehr noch als beim unlängst besuchten, wahrlich nicht leeren Gig von AMON AMARTH (der allerdings an einem Dienstag stattfand, während es diesmal Freitag war). Den Opener TWILIGHT FORCE habe ich mir nicht gegeben, pünktlich zu ACCEPT war ich dann aber doch am Start. Wer hätte jemals gedacht, dass die alten Herren, eine DER Metal-Institutionen aus Deutschland, mal für die vergleichsweise jungen Hüpfer aus Schweden die Vorgruppe geben würden? Vermutlich niemand, wobei man ja nach den Querelen der Vergangenheit durchaus froh sein muss, dass es die Truppe aus Solingen überhaupt noch gibt und man seit der Aufnahme von Sänger Mark Tornillo (immerhin auch schon 2009) so stabil unterwegs ist, was Veröffentlichungen betrifft.
Gegen die Songauswahl konnte man nichts sagen – vor allem scheint mittlerweile beim Großteil des Publikums angekommen zu sein, dass nicht mehr Udo Dirkschneider am Mikro steht und dass es auch abseits der Kracher aus den 1980ern gute Nummern von ACCEPT gibt. Und so herrschte meines Erachtens vom Opener „Stampede“ bis zum finalen „Balls To The Wall“ ausgezeichnete Stimmung, lediglich „Final Journey“ schien mir nicht so wirklich gefeiert zu werden. Aber die neueren „Stalingrad“ und „Teutonic Terror“ wurden euphorisch aufgenommen, haben sich ihren Platz unter den Klassikern aber auch redlich verdient. Die kamen natürlich auch nicht zu kurz – an „Restless And Wild“, „Princess Of The Dawn“ und „Fast As A Shark“ kann man sich ja auch kaum satt hören. Nur bei „Metal Heart“ stört mich das Hinauszögern (der geneigte Fan weiß, an welcher Stelle ich meine) mittlerweile einigermaßen.
Zum Start von SABATON gab es dann erstmal kurz Irritation – anstelle vom geliebten Intro „The Final Countdown“ (Europe) gab es das thematisch sehr passende, aber eben ungewohnte „In The Army Now“ (in der Cover-Version von SABATON) zu hören. Naja, irgendwie… ich weiß auch nicht. Das war aber (fast) der einzige Minuspunkt, der mir einfällt. Der andere betrifft die Akustik-Version von „The Final Solution“. Ja, wichtiges Thema, ja, schönes Lied, aber war mir dann doch zu viel des Guten. Eine Verbesserung gab es bei Frontmann Joakim Brodén zu vermelden: Den Bullshit-Laber-Faktor hat er im Gegensatz zur letzten Stippvisite in Wien tatsächlich reduziert. Ein mal „noch ein Bier“, ein bisschen Herumgeblödel mit dem neuen Gitarristen Tommy Johansson (der super in die Band integriert scheint) und noch ein bisschen Smalltalk, das war’s. Kein Vergleich zu dem ununterbrochenen Geplapper früherer Tage.
Songtechnisch ist es ja schon länger so, dass die Schweden aus dem Vollen schöpfen können. Daran hat sich natürlich nichts geändert, auch wenn der Schwerpunkt naturgemäß auf dem aktuellen Album „The Last Stand“ (2016) lag. Von jener Platte kamen 6 Nummern zu Ehren, darunter das tolle „Sparta“ („Huh-Hah!“) und das mittelprächtige „Blood Of Bannockburn“. Der Rest bot kaum Neues, was auch gut so ist – nur „The Price Of A Mile“ wurde von mir einmal mehr schmerzlich vermisst. Aber sonst machte man nichts falsch – „Ghost Division“ als traditioneller Operner, „Gott Mit Uns“ (in der mittlerweile ziemlich überflüssigen „Noch ein Bier“-Variante), „Carolus Rex“, „Primo Victoria“ in der Zugabe, „To Hell And Back“ als Rausschmeißer – was kann da schon passieren? Lediglich „Union (Slopes Of St. Benedict)“ fand ich etwas überraschend, war aber auch schwer in Ordnung.
Fazit: Was kann man da noch großartig sagen – die Begeisterung für SABATON will bei weiten Teilen des Publikums einfach nicht abreißen. Das hat mich anfangs ein wenig gewundert, mittlerweile verstehe ich es aber, auch wenn ich die Alben nach dem grandiosen „Carolus Rex“ (2012) nicht mehr ganz so ausdrucksstark finde. Diese Band zeigt deutlich, wie sehr sich harte Arbeit, Präsenz auf der Bühne und – nicht zu unterschätzen – ungetrübte Spielfreude auszahlen. Manchmal ist es direkt beängstigend, wie leicht den Schweden alles zu fallen scheint (was für mein Dafürhalten sogar eine kleine Gemeinsamkeit mit ihren Landsmännern AMON AMARTH darstellt). Bis auf ein wenig Kritik an den neueren Scheiben will mir zu dieser Band einfach nichts Negatives einfallen, schon gar nicht, was die Live-Performance betrifft. Weitermachen!